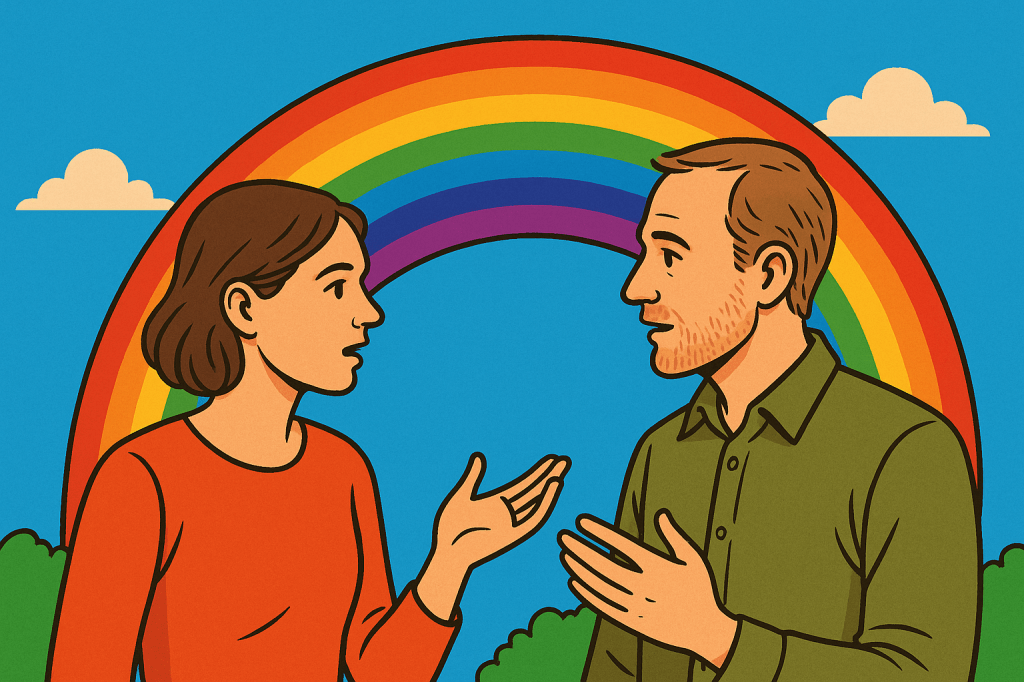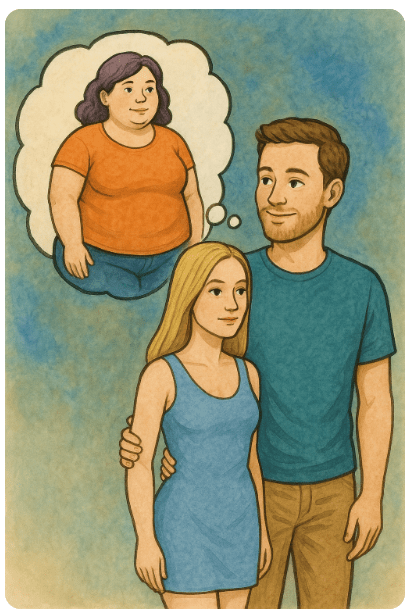Ich habe es ehrlich gesagt nie verstanden: Was genau soll schön daran sein, sich so zu betrinken, dass man kaum mehr geradeaus laufen kann, geschweige denn weiss, was man tut? Manche finden es lustig, im Rausch peinliche Dinge zu machen, anderen dabei zuzuschauen oder am nächsten Tag mit höllischen Kopfschmerzen aufzuwachen. Für mich klingt das eher nach Selbstquälerei, Schadenfreude oder Dekadenz.
Natürlich trinke ich auch mal ein Glas Wein oder einen Cocktail – wenn ein spezieller Anlass ansteht. Aber im Alltag? Nein, danke. Mir reicht eine Cola, ein Schweppes oder einfach ein Glas Wasser – und natürlich VIEL Kaffee. Ich brauche keinen Alkohol, um gute Gespräche zu führen, zu lachen oder einen schönen Abend zu haben.
Ein Beispiel dafür habe ich in Erinnerung, als ich mit meinem Chor am Europa Cantat in Pécs war. Abends trafen wir uns oft und „zogen um die Häuser“. Eines Abends kam ich zu einigen Choristen, die schon auf einer Terrasse sassen, und gesellte mich dazu. Ich bestellte eine Cola. Sofort meinte einer: „Was? Du bestellst nur Cola? Kein Bier?“ – Ich mag nun mal kein Bier, es ist mir viel zu bitter, und ausserdem brauche ich keinen Alkohol, um einen tollen Abend zu verbringen. Die Antwort kam prompt: „Also ich schon!“ Dieser Satz hat mich ehrlich gesagt schockiert. Dass man glaubt, ohne Alkohol keinen schönen Abend haben zu können, ist für mich schwer nachvollziehbar.
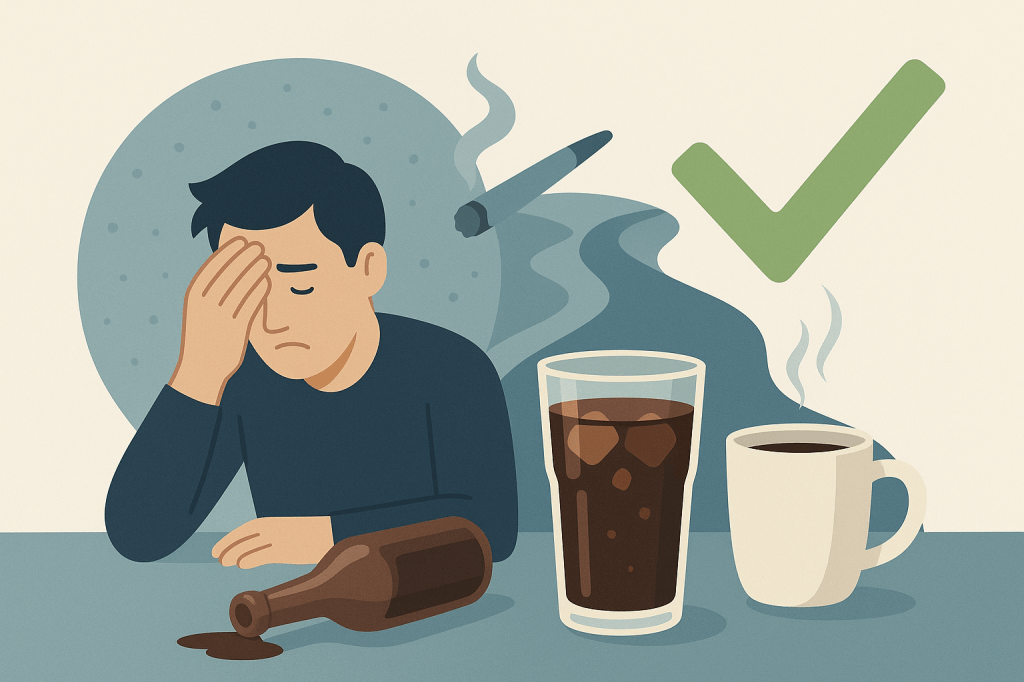
Und doch sehe ich, dass viele Menschen das anders erleben. Für manche gehört Alkohol einfach zum Feiern dazu, er vermittelt das Gefühl von Lockerheit, von Leichtigkeit und von Gemeinschaft. Andere empfinden es fast wie ein Ritual – das Glas Wein zum Essen oder das Bier nach Feierabend ist fest verankert. Wieder andere greifen dazu, weil sie Sorgen oder Stress vergessen wollen. Aber das löst die Probleme ja nicht wirklich. Im Gegenteil: Es verschiebt sie nur, und wenn man wieder nüchtern in der Realität landet, ist es meistens noch schlimmer.
Vielleicht bin ich in dieser Hinsicht besonders sensibel, denn ich habe in meiner Familie erlebt, wie gefährlich der Umgang mit Alkohol und Drogen sein kann. Mein Bruder hat sich in jungen Jahren mehrmals ins Koma gesoffen und wäre einmal fast gestorben, hätte man ihn nicht rechtzeitig in einer Toilette gefunden. Auch meine Kinder haben schon so viel getrunken, dass sie „blau“ waren. Und das, obwohl sie von mir nie ein solches Beispiel gesehen haben.
Dasselbe gilt fürs Kiffen: Ich habe es nie gemacht und werde es auch nie tun – und doch haben meine Kinder und Brüder damit experimentiert und tun es bis heute manchmal. Ich kann es noch weniger nachvollziehen, denn niemand soll mir erzählen, das sei harmlos oder „nur“ CBD. Es greift das Gehirn an, ob man will oder nicht. Und gerade wenn man im Teenageralter damit anfängt, ist das sicher nicht förderlich für die weitere Entwicklung.
Dazu kommt, dass der jüngste Bruder meines Vaters bereits mit zwölf Jahren anfing zu kiffen. Später kam er zu härteren Drogen – und mit nur 24 Jahren starb er an AIDS. Ich sage nicht, dass man automatisch zu härteren Drogen greift, wenn man kifft. Aber das Risiko, dass es irgendwann „mehr“ wird und im schlimmsten Fall so endet, ist viel grösser. Mich hat der Tod meines Onkels damals zutiefst abgeschreckt. Ich habe diese Erfahrung auch meinen Kindern immer wieder erzählt, in der Hoffnung, dass sie es verstehen. Aber gebracht hat es nichts. Sie nehmen keine harten Drogen, das nicht – doch sie kiff(t)en. Für mich ist das eigentlich schon der Anfang vom Ende und einfach nur unbegreiflich.
Ich möchte niemanden belehren. Jeder soll selbst entscheiden, wie er mit Alkohol oder Drogen umgeht. Aber für mich bleibt es ein Rätsel, wieso man Spass mit Kontrollverlust gleichsetzt – und warum man dafür die eigene Gesundheit riskiert. Vielleicht bin ich altmodisch – oder einfach nur nüchtern…