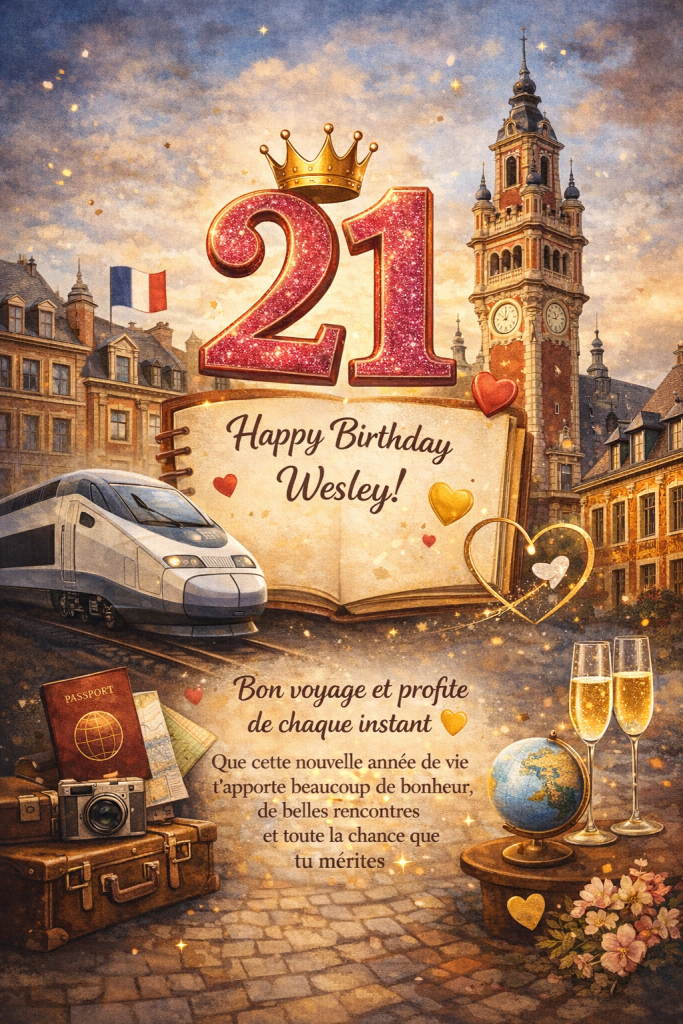Heute vor 21 Jahren, um 12.28 Uhr, kam mein Sohn per Kaiserschnitt zur Welt. Ich sehe den Kreisssaal noch immer ganz klar vor mir und erinnere mich an die grosse Erleichterung, als man mir dieses kleine Wesen zeigte: Was für ein hübsches Baby.
Natürlich sagen das alle Mütter. Das ist mir bewusst.
Wenn ich heute zurückblicke, staune ich darüber, wie schnell diese 21 Jahre vergangen sind. Viel zu schnell. Und sie waren nicht leicht – weder für ihn noch für mich. Es gab schwierige Zeiten. Und es gibt sie bis heute.
Als er fünf Jahre alt war, sagte er eines Tages, als ich ihn von der Vorschule abholte:
„Mama, dieses Leben gefällt mir nicht. Ich will nicht mehr.“
Dieser Satz hat mich tief erschüttert. Ich reagierte sofort, sprach mit der Schulleitung, und es wurden Massnahmen ergriffen. Ein Schulpsychologe wurde hinzugezogen. Man stellte eine leichte Dyslexie fest – doch rückblickend wurde viel zu wenig daraus gemacht.
In der Oberstufe wurde er gemobbt. Am Ende entwickelte er eine ausgeprägte Schulphobie. Die Rektorin und ich standen täglich in Kontakt. Schliesslich sorgte sie dafür, dass er sein letztes obligatorisches Schuljahr ausserhalb des eigentlichen Schulkomplexes, aber weiterhin im schulischen Rahmen, beenden konnte.
Und dann kam Corona.
Die Struktur, in der er sich befand, brach komplett zusammen. Es wurde nichts aufgefangen, nichts begleitet. Die Kinder waren auf sich allein gestellt. In diesem Abschlussjahr gab es keine Prüfungen – nur der Notendurchschnitt zählte.
(Zur Erklärung: In der Schweiz ist 6 die beste und 1 die schlechteste Note. Ab der Note 4 gilt eine Leistung als „genügend“.)
Mein Sohn hatte aufgrund seiner Schulphobie im gesamten Schuljahr nur eine einzige Note im Zeugnis: eine 5 in Mathematik. Das reichte nicht aus, um ihm das Abschlussdiplom zu geben. Er erhielt lediglich ein Attest über den Abschluss der obligatorischen Schulzeit.
Hinzu kam eine massive Angst vor Corona. Er zog sich völlig zurück und verschanzte sich in seinem Zimmer. Ich musste ihn regelrecht zwingen, wenigstens 10/15 Minuten pro Tag an die frische Luft zu gehen. Er rutschte in eine Depression. Psychologen lehnte er strikt ab – zu viele Enttäuschungen in all den Jahren, zu viel verlorenes Vertrauen.
Heute mache ich mir oft Vorwürfe.
Ich hätte eingreifen sollen. Auf eine Nachprüfung bestehen. Irgendetwas erzwingen.
Aber auch ich mache Fehler – Auch ich bin nur ein Mensch…
Seit fast sechs Jahren ist er nun überwiegend zu Hause. Im letzten Frühling fand er – eher zufällig – eine Arbeit, die ihm wirklich Freude machte. Er blühte auf. Ich war so erleichtert. Man lobte ihn, versprach ihm viel – auch mir gegenüber. Und dann wurde er von einem Tag auf den anderen entlassen. „Restrukturierung“, hiess es.
Ich bin überzeugt: Das war von Anfang an so geplant. Hätte man offen gesagt, dass man für zwei Monate Personal für einen Grossauftrag braucht, wäre es ehrlicher gewesen. So aber war es ein Schlag ins Gesicht – und ein Stich mitten ins Mutterherz.
Ich werde nie vergessen, wie er mir abends gegen 23h unter Tränen sagte, dass ihm und drei Kollegen fristlos gekündigt wurde.
Diese Erfahrung warf ihn um Monate zurück. Wieder Depression. Wieder Stillstand. Ich musste kämpfen, um ihn überhaupt dazu zu bringen, hin und wieder eine Bewerbung zu schreiben.
Im September 2025 bezahlten sein Vater und ich ihm eine zweitägige Schulung zum geprüften SUVA-Gabelstaplerfahrer. Wenigstens einmal tat sein Vater etwas für ihn. Auch das ist eine Baustelle: ein Vater, der nie wirklich da war, der spürbar machte, dass er die Schwester bevorzugt. Wie kann man nur? Aber Sohnemann hat die Prüfung mit Bravour und mit nur 2 Fehlern bestanden. Ich war sehr stolz auf ihn.
Mein Sohn tut mir oft unendlich leid. Mein Mutterherz schmerzt.
Er ist nicht dumm. Im Gegenteil: Er ist aufmerksam, informiert, empathisch. Er würde sein letztes Hemd hergeben, wenn er helfen kann. Aber sobald es um Arbeit geht, scheint eine unsichtbare Barriere da zu sein.
Und dann – im Dezember – geschah etwas.
Ich weiss nicht, was der Auslöser war. Aber er begann, sich autodidaktisch beizubringen, wie man PCs aufrüstet. Er baute für einen Freund einen kompletten Computer zusammen und installierte zwei Tage später telefonisch Windows 11. Er verkaufte Teile seines eigenen PCs, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen und etwas zum gemeinsamen Essen beizusteuern. Mit seinem Weihnachtsgeld kaufte er sich zwischen den Feiertagen neue Kleidung – schöne Stücke, alles im Ausverkauf. Ein neuer Stil. Er steht ihm. Wirklich sehr.
Und heute feiert er seinen 21. Geburtstag.
Ein Freund lud ihn ein, eine Woche bei ihm in Lille zu verbringen. Am 2. Januar reiste er frühmorgens mit dem TGV von Genf aus ab. Die Reise finanzierte er mit dem restlichen Geld aus dem Verkauf der PC-Komponenten – es war ihm wichtig, das selbst zu bezahlen.
Er versuchte ausserdem, zwischen Weihnachten und Neujahr einen kleinen Job zu finden, um vor Ort etwas Taschengeld zu haben. Leider ohne Erfolg. Das war frustrierend – und doch geht er weiter, auf seine eigene Weise.
Ich bin stolz auf ihn. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr ihm endlich neue Türen geöffnet werden könnte.
Ich sagte in meinem Umfeld einfach, dass – falls jemand ihm zu seinem Geburtstag eine kleine Aufmerksamkeit machen möchte – er diese vor Ort gut nutzen kann. Eine Arbeitskollegin, ein ehemaliger Arbeitskollege und ein Ex-Freund haben ihm ebenfalls etwas zukommen lassen. Der restliche Betrag kam aus der Familie – von Eltern, Grosseltern, seiner Schwester und Onkeln. So konnte ich ihm insgesamt 500 Franken schicken.
Soeben habe ich ein Video von meinem Sohn erhalten. Die Mutter seines Freundes hat extra für ihn eine Schwarzwälder Torte gebacken. Das kennt man in Nordfrankreich so nicht. Aber sein Freund habe seiner Mutter davon erzählt, und sie habe nur gelächelt und gesagt: „Ich liebe Herausforderungen.“
Die Torte sieht gut aus und sei gut gewesen – aber doch weit entfernt von meiner.
Balsam für mein Mutterherz.
Solche kleinen Momente berühren mich tief. Sie zeigen mir, dass er gesehen wird, dass er willkommen ist und dass es Menschen gibt, die sich Mühe für ihn geben. Und genau diese Augenblicke geben mir Hoffnung.
Und nun wünsche ich mir für dieses neue Jahr nur eines:
Dass es sein Jahr wird.
Er hat es verdient, endlich Glück zu haben.
Und endlich anzukommen.