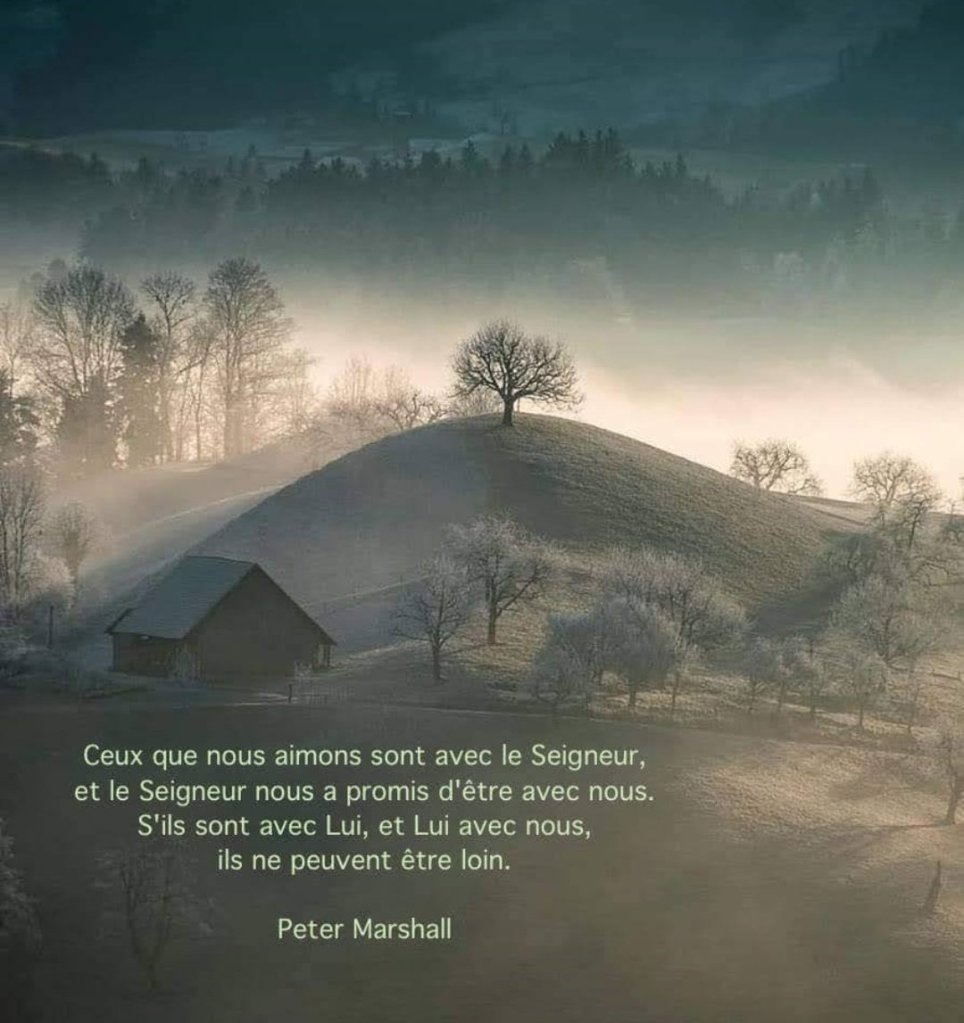Oft habe ich das Gefühl, wir unterschätzen, wie schwer es für junge Menschen heute ist – besonders für jene, die um die Jahrtausendwende oder danach geboren wurden. Sie wachsen in einer Welt auf, die wenig Ruhe kennt und viel verlangt.
Ich schreibe das als Mutter.
Bis zum vorletzten obligatorischen Schuljahr kam mein Sohn mehr oder weniger zurecht. Dann wurde er massiv gemobbt. Daraus entwickelte sich eine Schulphobie. Es gab Angstzustände, starke Bauchschmerzen und manchmal panikartige Flucht. Ich brachte ihn täglich zur Schule, holte ihn oft wieder ab. Es gab Tage, an denen ich ihn suchte, weil mich die Rektorin informierte, dass er nicht dort angekommen war. Es war eine sehr schwere Zeit.
Mein Sohn ist mit grosser Sicherheit hypersensibel – eine Eigenschaft, die nichts Schlechtes ist, sondern Tiefe und feine Wahrnehmung bedeutet. In einem rauen Umfeld kann sie jedoch sehr belastend sein. Mit viel Engagement fand die Rektorin für ihn einen Platz in einem schulnahen Projekt ausserhalb des Schulgebäudes. Dieser Ort gab ihm etwas Halt.

Dann kam Corona – mein Sohn 15.
Das Projekt wurde gestoppt. Begleitung und Informationen blieben aus. Er musste zu Hause bleiben – und wurde damit faktisch auf die Seite gelegt.
Letzten Sonntagabend sass mein Sohn weinend am Tisch und sagte:
„Ich bin jetzt 21, und die anderen – jene, die mich damals gemobbt haben – haben alle eine Ausbildung und arbeiten. Und ich bin einfach nur ein Nichts.“
Dieser Satz hat mir das Herz zerrissen. Denn er ist kein Nichts. Aber so fühlt es sich an, wenn man zu lange keinen Platz mehr hatte.
Gestern habe ich meinen Sohn zum Sozialamt begleitet. Sein Hausarzt hatte ihm geraten, sich an einen Sozialarbeiter zu wenden – er sei auf keinen Fall ein Einzelfall. Für meinen Sohn war dieser Schritt sehr schwer: hinzugehen, einen Termin zu vereinbaren und sich dabei quasi verletzlich zu zeigen. Auch mir tat es im Mutterherz weh. Aber er hat es getan. Am 23. Januar hat er einen Termin bekommen, und ich werde ihn begleiten. Und ich hoffe sehr, dass ihm geholfen werden kann – wie auch immer dieser Weg aussehen mag.
Vielleicht ist es an der Zeit, weniger zu vergleichen und mehr zu verstehen. Die Welt der 1960er-, 70er- oder 80er-Jahre ist nicht die heutige.
Was junge Menschen brauchen, ist kein Spott und keine Abwertung, sondern Anerkennung für das, was sie tragen müssen und mussten – und die Zuversicht, dass es Wege gibt. Auch dann, wenn sie später beginnen.